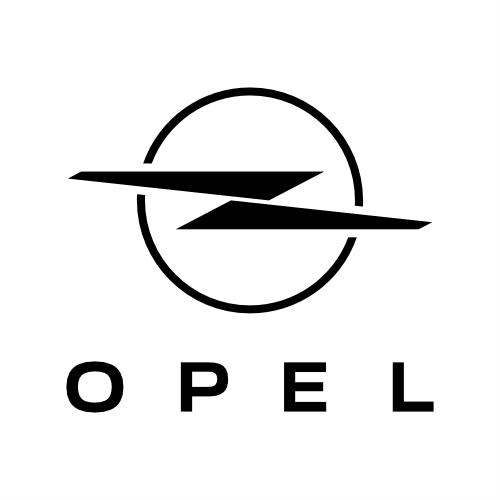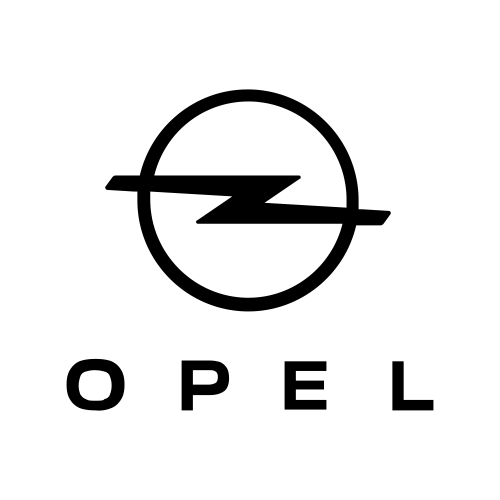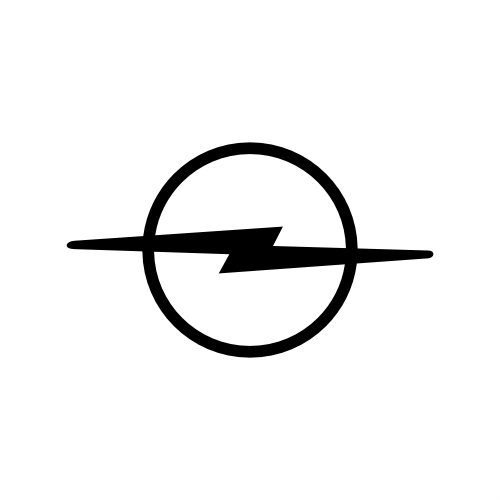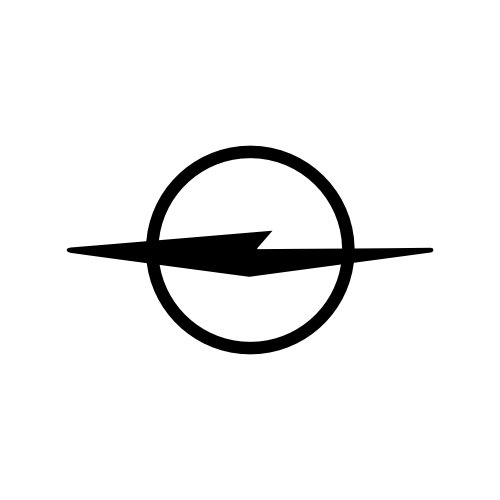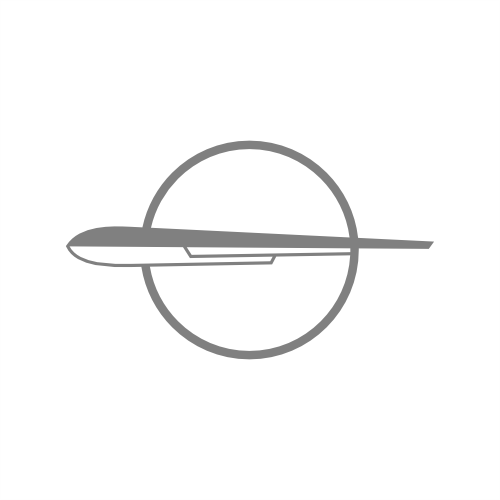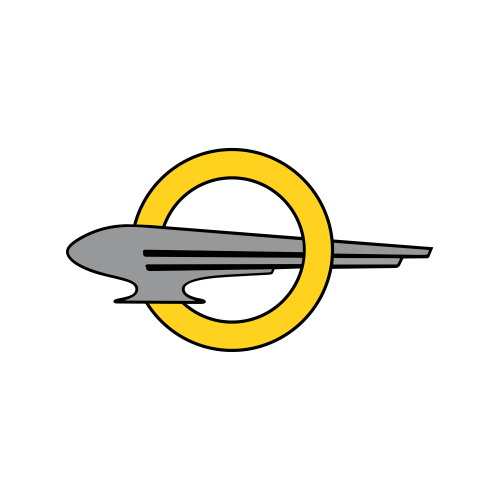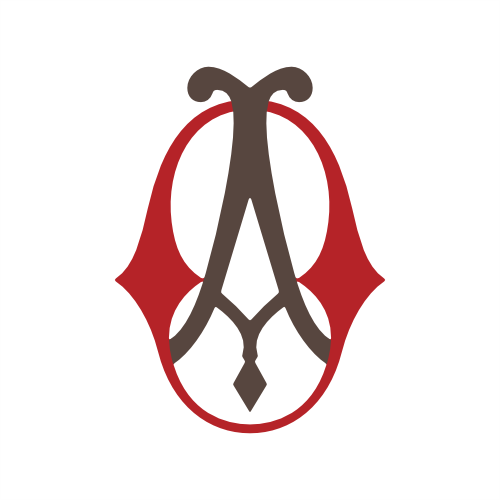Markenlexikon
Opel

Der Schlosser Adam Opel (1837 – 1895) begann 1863 in einer kleinen Werkstatt in Rüsselsheim mit dem Bau von Nähmaschinen. Da sich das Geschäft nach anfänglichen Schwierigkeiten gut anließ, konnte er 1868 eine eigene Fabrik errichten, die sich schnell zum führenden Nähmaschinen-Hersteller Deutschlands entwickelte. Die Begeisterung seiner fünf Söhne für das Radfahren brachte ihn dazu, ab 1886 auch Fahrräder zu bauen. Nach dem Tode des Vaters, der sich nie für Automobile begeistern konnte, erwarben die Opel-Brüder die Rechte am Lutzmann-Auto, das der Dessauer Schmied Friedrich Lutzmann (1859 – 1930) gerade entwickelt hatte. 1898 wurde der erste Opel Lutzmann vorgestellt. Doch weder er noch das Nachfolgemodell konnten in ausreichenden Stückzahlen verkauft werden. Opel gab den Automobilbau vorerst wieder auf. Bis zur Jahrhundertwende produzierte die Firma ausschließlich Nähmaschinen und Fahrräder.
Das erste Opel-Motorrad kam 1901 auf den Markt. Zur gleichen Zeit wurde Opel alleiniger Importeur der französischen Darracq-Automobile für Deutschland und Österreich-Ungarn. Diese Lizenz umfasste auch die Genehmigung Darracq-Fahrzeuge selbst zu produzieren und mit eigenen Karosserien zu versehen. Sie kamen als Opel-Darracq auf den Markt. Der so genannte Doktorwagen (1909) – weil ihn Ärzte gerne für ihre Hausbesuche verwendeten – war das erste Fahrzeug, das den Opel-Schriftzug am Kühler trug. Zur gleichen Zeit begann Opel mit der Produktion von leichten Lastwagen.
1924 brachte Opel einen Kleinwagen heraus, der wegen seiner grasgrünen Farbe und den hinten fehlenden Stoßdämpfern den inoffiziellen Namen Laubfrosch bekam (offiziell: Opel 4/12 PS). Dieser spartanische Zweisitzer, der erstmals in Deutschland am Fließband gebaut wurde, und der dem französischen Citroën 5CV nachempfunden war, brachte der Firma so große Gewinne, dass sie 1928 von einer Kommanditgesellschaft in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden konnte.
Für Furore sorgte zu dieser Zeit Fritz von Opel (1899 – 1971), der Enkel Adam Opels, mit seinen Raketenwagen, die er gemeinsam mit Friedrich Wilhelm Sander, Max Valier und Julius Hatry gebaut hatte. Am 23. Mai 1928 erreichte er mit dem von 24 Feststoffraketen angetriebenen Opel RAK 2 auf der Berliner AVUS die Rekordgeschwindigkeit von 238 km/h. Am 30. September 1929 unternahm Fritz von Opel mit dem Raketenflugzeug Opel-Sander RAK 1 auf dem Frankfurter Flugplatz Rebstock den ersten Raketenflug eines Menschen (Dauer: 10 Minuten, Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h, max. Höhe: 30 Meter), legte jedoch eine Bruchlandung hin, die er unverletzt überstand.


1928 war Opel der führende deutsche Fahrzeughersteller und -exporteur, außerdem der einzige, der über ein großes Händlernetz verfügte. Um die Finanzen des Unternehmens stand es trotzdem nicht gut. Die Umstellung der Werke auf die moderne Fließbandtechnik hatte enorm viel Geld verschlungen. Hinzu kam die fällige Erbschaftssteuer infolge mehrerer Todesfälle in der Opel-Familie. Die Brüder Wilhelm Albert von Opel (1871 – 1948) und Friedrich Franz Opel (1875 – 1938) hatten das Unternehmen bereits 1926 dem US-Autokonzern General Motors zum Kauf angeboten, eine positive Antwort erhielten sie jedoch erst ein Jahr später. 1929 erwarb General Motors schließlich 80 Prozent des Unternehmens – kurz vor Beginn der Weltwirtschaftskrise. Ende 1929 gingen die Absatzzahlen von Opel drastisch zurück, sodass die Produktion zeitweise gestoppt werden musste. Doch dank der US-Finanzspritze überlebte die Firma die schwierigen Jahre und stand schon 1931 wieder an der Spitze der deutschen Automobilhersteller. Nun übernahm General Motors auch die restlichen 20 Prozent der sich noch in Familienbesitz befindlichen Opel-Aktien. 1926 hatte GM bereits die britische Autofirma Vauxhall/Bedford erworben, was später zu einer engen Zusammenarbeit zwischen Opel und Vauxhall führte. Wilhelm von Opel saß noch bis 1945 im Aufsichtsrat der Adam Opel AG.
Mit dem Lastwagen Opel Blitz stieg Opel ab 1931 zum größten deutschen Nutzfahrzeughersteller der Vorkriegszeit auf. 1935 gab es den Olympia (so genannt wegen der Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin), der erstmalig in Deutschland eine selbsttragende Ganzstahlkarosserie hatte, und den preisgünstigen Kleinwagen P4 (1.650 Reichsmark), der neben den DKW-Frontwagen zu den Vorläufern des Volkswagens zählt. 1936 war Opel der größte europäische Fahrzeughersteller. 1937 wurden das Oberklassemodell Admiral und das Mittelklassemodell Kadett vorgestellt, das sich außerordentlich gut verkaufte. Im gleichen Jahr beendete Opel die Fahrradproduktion; die Fertigungsanlagen wurden von NSU übernommen. Die Motorradproduktion war schon 1930 eingestellt worden. 1939 kam noch der Kapitän, der kleine Bruder des Admiral, auf den Markt, aber diesem Modell war keine lange Dienstzeit mehr vergönnt. Ab 1940 stand Opel voll unter Kontrolle der nationalsozialistischen Regierung und stellte nun hauptsächlich Militärfahrzeuge, Motoren, Torpedos und Flugzeugteile her.
1946 lief in Rüsselsheim zunächst die Nutzfahrzeug-Produktion wieder an. Die reguläre Pkw-Produktion begann erst 1947 mit dem alten Vorkriegs-Olympia. Die Produktionsanlagen des Kadett wurden als Reparationsleistung in die Sowjetunion gebracht, wo dieses Modell bis 1954 als Moskwitsch 400 vom Band lief. 1948 folgte der größere Kapitän, ebenfalls ein Vorkriegsmodell, 1953 der Olympia Rekord (der erste neue Nachkriegs-Opel) und 1957 der sehr amerikanische Rekord P1. Der Name Rekord blieb bis 1986 in Gebrauch, als diese Modellreihe vom Omega abgelöst wurde. Ab 1962 gab es wieder ein Mittelklasse-Fahrzeug mit dem Namen Kadett, das in einem neuerrichteten Werk in Bochum vom Band lief und bis 1991 in Produktion blieb (fünf Modellreihen).
Eins der populärsten Opel-Modelle war der sportliche Manta (1970 – 1988), die Coupé-Version des Mittelklasse-Modells Ascona (1970 – 1988), das zur gleichen Zeit herauskam. Vorbild für den Manta war der Ford Capri von 1969. Ähnliche Berühmtheit erlangte auch der vom Kadett B abgeleitete Sportwagen Opel GT, der von 1968 bis 1973 rund 100.000 mal gebaut wurde. Weniger Erfolg hatte Opel mit seinen Oberklasse-Limousinen (Admiral, Diplomat, Kapitän, Senator), was einerseits am zeitweise amerikanisch geprägten Design und den großen V8-Motoren lag, andererseits auch daran, dass der Marke als Volumenhersteller das nötige Image fehlte.
1975 verlagerte die Opel-Muttergesellschaft General Motors die Nutzfahrzeugproduktion nach Großbritannien zu Vauxhall. 1982 brachte Opel mit dem Corsa als letzter deutscher Massenhersteller einen Kleinwagen auf den Markt; VW und Ford waren in dieser Klasse bereits mit den Modellen Polo (ab 1975) und Fiesta (ab 1976) vertreten.
Die Zugehörigkeit zum GM-Konzern (Bedford, Buick, Cadillac, Chevrolet, Daewoo, GMC, Isuzu, Holden, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saab, Saturn, Vauxhall) führte dazu, dass sich seit den 1960er Jahren viele Modelle dieser Hersteller nur noch durch Namen, Firmenlogo und Austattung unterschieden. Opel war die GM-Hauptmarke in Kontinentaleuropa (in Großbritannien und Irland wurde die Marke Vauxhall verwendet) und im Nahen Osten. Außerdem wurden Opel-Modelle zeitweise in Australien, China, Indien, Russland, Singapur, Südafrika und Taiwan verkauft. Außerhalb dieser Gebiete und Länder kamen einige Opel-Modelle als Chevrolet und Pontiac (Nord-, Mittel-, Südamerika), Saturn (Nordamerika), Isuzu (Asien) und Holden (Australien) in den Handel. Der Ascona/Manta war das einzige Modell, das in den USA zeitweise als Opel verkauft wurde. Die Geländewagen waren Abkömmlinge von Isuzu (Frontera, Monterey) und Chevrolet/Daewoo (Antara), die auch dort gebaut wurden.


Opel war dem deutschen Branchenprimus VW lange Zeit dicht auf den Fersen, vor allem mit den überaus erfolgreichen Modellen Kadett B (1965 – 1973), Ascona B (1975 – 1981), Kadett D (1979 – 1984; der erste Opel mit Frontantrieb), Kadett E (1984 – 1991), Astra F (1991 – 1998) und Vectra A (1988 – 1995). Zum meistgebauten Opel aller Zeiten avancierte der Astra F, der auch in vielen anderen Ländern der Welt gebaut und verkauft wurde. Der Astra Caravan war zudem von 1993 bis 2000 der meistverkaufte Kombi in ganz Europa. Auch der sehr gefällig gestylte Vectra A, der Nachfolger des Ascona C, verkaufte sich sehr gut. Zeitweise Jahre stand er auf dem zweiten Platz der europäischen Zulassungsstatistik. Gravierende Qualitätsprobleme in den 1990er Jahren, u.a. verursacht durch rigorose Sparmaßnahmen, führten jedoch dazu, dass sich viele Autokäufer enttäuscht von Opel abwandten und zu anderen Marken wechselten.
1998 kehrte Opel mit dem mittelgroßen Transporter Movano, der gemeinsam mit Renault (Renault Master) und Nissan (Nissan Interstar) entwickelt wurde, wieder in den Nutzfahrzeugsektor zurück. 2001 kamen der Kleintransporter Combo (auf Basis des Corsa) und der ebenfalls gemeinsam mit Renault und Nissan entwickelte Vivaro (Renault Traffic, Nissan Primastar) auf den Markt.
2005 wurde die nichtbörsennotierte Adam Opel AG in eine GmbH umgewandelt. Infolge der weltweiten Wirtschaftskrise 2008/2009 kam General Motors in schwere finanzielle Bedrängnis, die auch negative Auswirkungen auf die europäischen GM-Töchter hatte: Saab musste im Februar 2009 Insolvenz anmelden, GM selbst im Juni 2009. Das Insolvenzverfahren wurde in nur vierzig Tagen abgewickelt. Die europäische Tochter GM Europe, zu der Opel, Vauxhall und Saab gehörten, sollte zunächst an den kanadisch-österreichischen Fahrzeugzulieferer Magna International und die russische Sberbank verkauft werden. Dann entschied sich das neue GM-Management jedoch dazu, GM Europe selbst zu behalten. 2009 löste General Motors die Europa-Zentrale GM Europe in Zürich auf; die einzelnen Unternehmen wurden nun von ihren jeweiligen Zentralen aus geleitet. 2011 kehrte Opel wieder zur Rechtsform der Aktiengesellschaft zurück. Der Versuch Opel an Volkswagen zu verkaufen, scheiterte 2014 an unterschiedlichen Kaufpreisvorstellungen. 2017 veräußerte GM sein gesamtes Europa-Geschäft (Opel, Vauxhall) mit Werken in Eisenach (Opel), Gliwice (Opel), Kaiserslautern (Opel), Luton (Vauxhall), Ellesmere Port (Vauxhall), Rüsselsheim (Opel) und Zaragoza (Opel) schließlich an die französische PSA Groupe (Peugeot, Citroën). Das Unternehmen wurde daraufhin in Opel Automobile GmbH umbenannt. Infolge des Zusammenschlusses von PSA (Citroën, DS, Opel, Peugeot, Vauxhall) und FCA Fiat-Chrysler Automobiles (Abarth, Alfa-Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Fiat, Lancia, Maserati, Ram) gehört Opel seit 2021 zum Stellantis-Konzern.
Gebaut wurden/werden die Opel-Modelle in Rüsselsheim, Bochum (1962 – 2014), Kaiserslautern (seit 1966), Eisenach (seit 1992), Gliwice/Polen (seit 1998), Antwerpen/Niederlande (1924 – 2010), Zaragoza/Spanien (seit 1982), Ellesmere Port/Großbritannien (seit 1963; Vauxhall) und St. Petersburg (2007 – 2015).
Text: Toralf Czartowski • Fotos: Unsplash.com, Pixabay.com, Public Domain